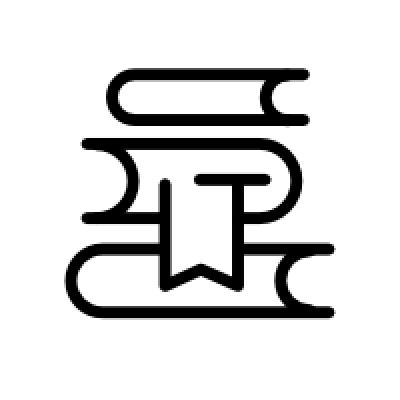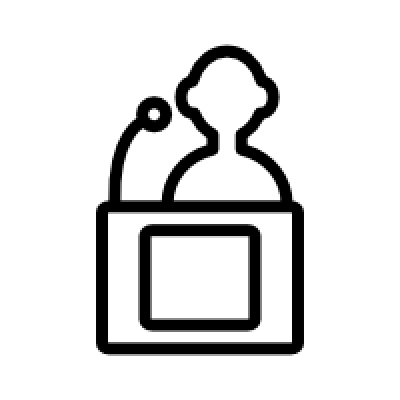Inhaltsverzeichnis
Konflikte zwischen der Stadt und der Landschaft Basel
Einleitung
Zu Beginn des 16. Jh. konsolidierte sich Basel als eigenständige Stadtrepublik mit verschiedenen Untertanengebieten im Umland und trat 1501 der Eidgenossenschaft bei. Ab 1521 löste sich Basel von der bischöflichen Oberhoheit und führte 1529 die Reformation ein, basierend auf der von Oekolampads ausgearbeiteten Reformationsverfassung. Zudem stürmten Anfang Februar 1529 Menschen das Münster, um als «Götzen» wahrgenommene Symbole wie Statuen zu zerstören – ein Ereignis, das als «Basler Bildsturm» bekannt wurde. 1585 musste die Stadtrepublik dem Bischof eine finanzielle Abgeltung zahlen, sicherte sich damit jedoch ihre Unabhängigkeit und den Besitz ihrer damaligen Territorien.
Konflikte zwischen der Stadt und der Landschaft Basel
Über Jahrhunderte hinweg prägten Konflikte das politische Gefüge der Eidgenossenschaft - so ebenfalls in Basel zwischen Stadt und Landschaft. Sie spiegelten tiefgreifende strukturelle Ungleichheiten wider - verstärkt durch neue politische Ideen, wie sie etwa im Zuge der Französischen Revolution aufkamen.
1525 kam es zum Bauernaufstand der Basler Landschaft gegen städtische Abgabepflichten. Durch die Vermittlung eidgenössischer Orte konnte der Konflikt beigelegt und einige Verpflichtungen reduziert werden.
1585 Zahlung der Ablösesumme an den Fürstbischof.
1591-94 Rappenkrieg: Die Erhöhung des Weinungelds zur Abfindungsfinanzierung der Ablösesumme führte zu einem Aufstand der Landbevölkerung gegen die Stadt.
1653 Bauernkrieg: Basel war ebenfalls von grossflächigen Aufständen der Untertanen gegen die Obrigkeit betroffen.
1798-1803 Helvetische Republik: Basel war Teil eines zentralistisch organisierten Kantons; starke Spannungen zwischen Stadt und Landschaft. In den Jahren vor der Helvetischen Republik mehrten sich die Stimmen für Reformationen, in Basel Peter Ochs.
1803-1814 Mediation: Wiederherstellung des föderalistischen Systems; Kanton Basel wurde erneut unabhängig, bestehend aus drei Bezirken (Basel-Stadt, Liestal und Waldenburg) und einer eigenen Verfassung; Konflikte blieben bestehen. Die Kontinentalsperre Napoleons führte zu weiteren wirtschaftlichen Anspannungen und die Unterbringung Alliiertentruppen 1813/14 in Basel (Stadt wie Landschaft) verschärfte die Situation zusätzlich durch Ressourcenknappheit (Raum und Nahrungsmittel) und einem Krankheitsausbruch (vermutlich Typhus), der zahlreiche Opfern in der Bevölkerung forderte.
1814-1830/31 Restauration: Rückkehr zu vormodernen Machtverhältnissen zugunsten der städtischen Oberschicht; Basler Zünfte forderten erfolglos die Wiedereinführung der Leibeigenschaft; Verfassungsrevision mit dem Grossen Rat auf Lebenszeit. Die Zusammensetzung des Grossen Rates spiegelte die Macht- nicht die Bevölkerungsverhältnisse der Stadt zur Landschaft wider: 90:60 statt 55:95 Sitzen.
Der Ausbruch des Vulkans Tambora (1815) führte 1816 zum sogenannten «Jahr ohne Sommer» mit massiven Ernteausfällen und Nahrungsknappheit in ganz Europa und verschärfte auch in Basel die soziale und wirtschaftliche Lage zusätzlich.
1830-1833 Zunehmende Radikalisierung der Landgemeinden; politisches wie sozioökonomisches Ungleichgewicht führten zu immer wieder aufflammenden Aufständen der Landschaft; es kristallisierte sich heraus, dass ein einziger Kanton Basel nicht die Lösung war. Es kam zur Teil- und schliesslich zur Totaltrennung des Kantons Basel.
1830-1833: Krisen, Aufstände, Trennung
Die Schweiz zwischen 1830 und 1833 war geprägt von Fragen nach Freiheit, Volkssouveränität und Bürgerrechten, ebenso Basel. Basel-Stadt war der Idee einer Kantonstrennung gegenüber nicht abgeneigt, jedoch überrascht, als ihr die Hauptverantwortung für eine mögliche Teilung zugeschrieben wurde. Die Selbstwahrnehmung als wohlwollende Stadtobrigkeit gegenüber ihrer ländlichen Untertanen machte sie blind und taub gegenüber deren Kritik und Nöten. In der folgenden Zeit kam es zu verschiedenen Konflikten und Unabhängigkeitserklärungen verschiedener landschaftlicher Gemeinden.
1831 veränderten sich die Verhältnisse Basels innerhalb weniger Monate radikal. Am 4. Januar 1831 traten Delegierte von 72 Landsgemeinden zusammen und forderten Gleichberechtigung in der politischen Mitbestimmung. Stephan Gutzwiller und Anton von Blarer-Schwab traten als zentrale als Wortführer der Landschaft hervor. Im Februar/März 1831 schlug die Stadtregierung den Aufstand militärisch nieder und löste die provisorische Regierung der Landschaft auf. Mehrere Köpfe, darunter Stephan Gutzwiller, wurden in Abwesenheit strafrechtlich verfolgt und verurteilt.
Basel legte seinen Stimmberechtigten eine neue kantonale Verfassung vor, die einige wenige Bürger-, Freiheits- und Partizipationsrechte verbriefte. Sie wurde von der Stadt einstimmig, von der Landbevölkerung zu zwei Dritteln angenommen. Die Trennung war damit vorerst verworfen. Zwar besass die Landschaft die Mehrheit im Grossen Rat (79:75), zugleich gab es erheblich praktische Hindernisse für die politische Beteiligung: der lange Weg zur Stadt; Wahlen fanden werktags statt, was auch mit einem städtischen Advokaten kaum realisierbar war.
Im Mai 1831 kam es erneut zu Aufständen (u.a. um Liestal mit provisorischem Regierungssitz). Dieses Mal scheiterte die Stadt an einer gewaltsamen Unterdrückung und im Verlaufe des Sommers schritt die eidgenössische Tagsatzung militärisch ein; sie forderte die Stadt auf, der Landschaft entgegenzukommen. Basel führte im November 1831 eine Konsultativabstimmung zum Kantonsverbleib durch. Sie drohte den Landgemeinden mit dem Entzug des Verwaltungsrechts, falls sie für eine Trennung stimmen sollten. Ein grösserer Teil der Gemeinden boykottierte die Abstimmung, woraufhin die Stadt diesen das Verwaltungsrecht im Februar/März 1832 entzog.
Der Wunsch nach Unabhängigkeit ließ sich jedoch nicht unterdrücken. Im Gegenteil: der Druck wuchs. Die Gemeinde Gelterkinden - dem städtischen Lager treu - forderte von Basel militärische Unterstützung und wurde infolgedessen im April 1832 von landschaftlichen Truppen angegriffen – dem sogenannten Sturm von Gelterkinden.
Die Konflikte schwelten weiter, bis es im August 1833 zu einem erneuten, größeren Gefecht zwischen Stadt und Landschaft kam. Beim Kampf an der Hülftenschanze unterlagen die städtischen Truppen denjenigen der Landschaft. Noch im gleichen Monat – am 26. August 1833 – anerkannte die eidgenössische Tagsatzung die Trennung: Basel-Stadt und Basel-Landschaft wurden offizielle Halbkantone1.
Nach der Trennung
Nach der Trennung 1833 standen Basel-Stadt und Basel-Landschaft vor jeweils eigenen, dennoch eng miteinander verknüpften Herausförderungen. Die Realität war - und ist bis heute - komplex: es galt, eigene Strukturen wie Verfassung, Verwaltung und Wirtschaftsordnung aufzubauen und deren Finanzierung zu sichern. Es mussten Lösungen für gemeinsam genutzte Institutionen und Infrastrukturen gefunden werden, beispielsweise die Universität oder dem später aufkommenden öffentlichen Verkehr - Herausforderungen, die bis heute nachwirken.
Schon Artikel 1 des Tagsatzungsbeschlusses vom 26. August 1833 hielt ausdrücklich fest, dass eine freiwillige Wiedervereinigung möglich sei: […] jedoch unter Vorbehalt freiwilliger Wiedervereinigung […]. In der Folgezeit gab es immer wieder konkrete Wiedervereinigungsbestrebungen:
1912 Rudolf Gelpke initiierte den Wiedervereinigungsverband
1932 Lancierung des Initiativebegehrens «Wiedervereinigungsinitiative», die 1936 vom Stimmvolk beider Kantone angenommen wurde. Ebenso die "Wiedervereinigungsinitiative" 1938. Die Umsetzung verzögerte sich jedoch aufgrund des 2. Weltkriegs. 1947/48 lehnte die Bundesversammlung die nötige Verfassungsänderung der beiden Basel ab.
1958 die Standesinitiative JA wurde von der Baselbieter Bevölkerung angenommen; in Basel-Stadt einstimmig vom Grossen Rat (sie wurde der Bevölkerung nicht vorgelegt).
1960 Wiedervereinigungsartikel JA wurde von der Bevölkerung Basel-Landschafts angenommen; beide Kantone wählten einen gemeinsamen Verfassungsrat. 1969 fand die finale Abstimmung über die Kantonsverfassungen BS/BL statt. Sie wurde in Basel-Stadt angenommen, in Basel-Landschaft jedoch abgelehnt – die Wiedervereinigung scheiterte.
2014 Nach erneuter Initiative stimmte Basel-Stadt wieder zu, Basel-Land lehnte abermals ab.
Eine Herausforderung stellt die jeweils halbe Standesstimme dar, über die Basel-Stadt und Basel-Landschaft jeweils verfügen. Für eine mögliche Fusion gilt als Voraussetzung, dass beide Kantone zunächst eine volle Standesstimme erhalten - Befürworter orientieren sich dabei am Kanton Jura, der 1979 bei seiner Ablösung von Bern von Anfang an eine ganze Stimme2 erhielt.
Die Trennung markiert einen historischen Bruch. Viele Herausforderungen wurden und werden mit bilateralen Verträgen, Gremien und Organisationen gemeistert – die lange gemeinsame Geschichte der beiden Basel prägt ihr Verhältnis bis heute und lässt Raum für Autonomie ebenso wie für Annäherung.
Einzelnachweise
- ↑ Seit der Verfassungsrevision 1999 wird der Begriff Halbkanton offiziell nicht mehr benutzt.
- ↑ Zu dieser Diskussion s. a. die Wann werden Halbkantone für voll genommen? von David Zuberbühler
Autor*in der ersten Version: Nathalie Wüthrich, 08/05/2025
Letzte Änderung: 16/07/2025
Bibliografie
Literatur
- Regula Argast, Marc Fehlmann, André Salvisberg, Dominik Sieber, Susanne Bennewitz, Sabine Braunschweig, Flavio Häner, und Kevin Heiniger. Hinter der Mauer, vor der Moderne : Basel 1760-1859. Basel: Christoph Merian Verlag, 2024; insbes. André Salvisberger, Walter Hochreiter, 1760-1817, S. 18-41 sowie André Salvisberg, 1817-1840, S. 124-133.
- Susanna Burghartz, Marcus Sandl, und Daniel Sidler. Aufbrüche, Krisen, Transformationen : zwischen Reformation und Revolution : Basel 1510-1790. Basel: Christoph Merian Verlag (2024), insbes. Daniel Sidler und Marcus Sandl, Politische Neuorientierung und reformatorischer Aufbruch (1510-1580); in: Aufbrüche, Krisen, Transformationen, Basel: Christoph Merian Verlag (2024), S. 20-59.
- Christof Wamister, Die Umkehr der Stäbe: Rudolf Gelpke gründete 1914 den Verband für die Wiedervereinigung beider Basel und argumentierte als Erster konsequent mit wirtschaftlichen Argumenten. Später distanzierte er sich von der Bewegung; Basler Stadtbuch (2014), S. 65-67; Online-Zugriff über: https://www.baslerstadtbuch.ch/stadtbuch/2014/2014_3320.html (Zugriff am: 23.04.2025).
- Casimir Hermann Baer, August Huber, und François Maurer-Kuhn. Vorgeschichtliche, römische und fränkische Zeit ; Geschichte und Stadtbild ; Befestigungen, Areal und Rheinbrücke ; Rathaus und Staatsarchiv. Unveränd. Nachdruck 1971 der Ausgabe 1932 mit Nachtr. von François Maurer. Basel: Birkhäuser, 1971, S. 65-75.
- Hans-Rudolf Heyer. Die Kunstdenkmäler der Schweiz [...]. Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Landschaft Bd. 1. Der Bezirk Arlesheim / Auf Grund von Vorarbeiten von Ernst Stockmeyer verf. von Hans-Rudolf Heyer; Einleitung. Basel: Birkhäuser (1969), S. 3-14. Online-Zugriff über: https://ekds.ch/library/597257b74cac4a88b62825370b708f5a (Zugriff am: 30.04.2025)
- Sammlung der Gesetze und Beschlüsse wie auch der Polizei-Verordnungen welche seit 26. August 1833 für den Kanton Basel-Stadt erlassen worden. Basel: Schweighauser; Benno Schwabe, 1838. Universitätsbibliothek Basel, UBH GesS BS 1b; Online-Zugriff über: https://www.e-rara.ch/bau_1/doi/10.3931/e-rara-92096 (Zugriff am: 30.04.2025).
Presse
- Ariane Gigon, Die scheinbar unmögliche Heirat der beiden Basel; in: swissinfo.ch (15. September 2014), (Zugriff am: 30.04.2025).
- Thomas Dähler, Die beiden Basel machen in Bern Druck; BaZ Online (06.02.2024); (Zugriff am: 02.05.2025).
- Thomas Dähler, Nein zum vollen Standesrecht für die beiden Basel; BaZ Online (10.06.2024); (Zugriff am: 02.05.2025).
Onlinequellen
- Bernard Degen; Jürg Tauber; Werner Meyer; Hans Berner; Niklaus Röthlin; Matthias Manz; Ruedi Brassel-Moser: "Basel (Kanton)", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), (13.01.2016); (Zugriff am: 30.04.2025).
- Bernard Degen; Rolf d'Aujourd'hui; Werner Meyer; Hans Berner; Ruedi Brassel-Moser; Niklaus Röthlin; Philipp Sarasin: "Basel-Stadt", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), (30.05.2017); (Zugriff am: 30.04.2025).
- Bernard Degen; Sibylle Rudin-Bühlmann; Kaspar Birkhäuser: "Basel-Landschaft", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), (29.05.2017); (Zugriff am: 30.04.2025).
- Sara Janner, Peter Ochs und die Revolution von 1798: Vom “Grand Tribun” zum “Citoïien helvétien”; Blogbeitrag in: StadtGeschichte Basel (08.12.2021/31.01.2024); (Zugriff am: 30.04.2025).
- Martin Leuenberger, Gründung des Kantons (s.d.), (Zugriff am: 30.04.2025).
- Unser Kanton – ein Überblick (s.d.); (Zugriff am: 30.04.2025).
- Roger Jean Rebmann, Bestrebungen zur Wiedervereinigung 1933-1969, altbasel. ch (08.11.2012); (Zugriff am: 30.04.2025).
- Marc Bühlmann, Debora Scherrer 2025. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Kantonsfusion Basel-Stadt und Basel-Landschaft 2011-2014, Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern; (Zugriff am: 30.04.2025).
- Marc Bühlmann, Peter Gilg, Hans Hirter, François-L. Reymond, Debora Scherrer 2025. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Dossier: Kantonszusammenarbeit und Fusionsbemühungen Basel-Stadt und Basel-Landschaft , 1968- 2014; Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern; (Zugriff am: 30.04.2025).
- Ruedi Epple, Wiedervereinigung I (s.d.); (Zugriff am: 30.04.2025).
- Ruedi Epple, Wiedervereinigung II (s.d.); (Zugriff am: 30.04.2025).
Zitiervorschlag
Nathalie Wüthrich, «Kantonstrennung: Basel», Lexikon des Jura / Dictionnaire du Jura (DIJU), https://diju.ch/d/notices/detail/1004009-kantonnstrennung-basel, Stand: 15/01/2026.